Laufende Verbundprojekte
»InnoWaerm« - Hochtemperaturbeständige Leichtbau-Wärmeübertrager und Reaktoren für die Mobilität von morgen
Mit Brennstoffzellen betriebene Elektromobile benötigen eine hohe Energieeffizienz, die stark vom eingesetzten Wärmeübertrager abhängt. Der Werkstoff Titanaluminid ermöglicht es temperaturstabile Wärmeübertrager herzustellen, doch die rissfreie Verarbeitung des Werkstoffs bereitet Schwierigkeiten. Im Vorhaben InnoWaerm wird eine neuartige Kombination aus additivem Fertigungsverfahren (Laser Powder Bed Fusion) mit einem spezifischen Vorwärmverfahren eingesetzt, wodurch die rissfreie Verarbeitung durch die stabile Verarbeitungstemperatur ermöglicht wird. Gleichzeitig kann mit diesem Verfahren ein Wärmeübertrager verwirklicht werden, der leicht und funktionsoptimiert ist.
Durch die Gewichtseinsparung in Kombination mit der hohen Temperaturstabilität des Werkstoffs können Hochtemperatur-Wärmeübertrager aus intermetallischem Titanaluminid in einem funktionsoptimierten Design entwickelt und validiert werden. InnoWaerm leistet einen entscheidenden Beitrag zur Energieeffizienz von Brennstoffzellen, wie sie in der Luftfahrt, der Elektromobilität und der Energiewirtschaft benötigt werden. Als nächster Schritt in Richtung einer wirtschaftlichen Verwertung wird eine Gründung oder Lizenzierung der Technologie an Hersteller von Anlagen des additiven Fertigungsverfahrens angestrebt.
Projektinformationen
| Titel | »InnoWaerm« - Hochtemperaturbeständige Leichtbau-Wärmeübertrager und Reaktoren für die Mobilität von morgen |
|---|---|
| Laufzeit | 01.11.2025 bis 10.10.2027 |
Projektträger |
|
| Fördergeber | BMFTR |
| Bestehende Projektwebseite |
https://www.validierungsfoerderung.de/validierungsprojekte/innowaerm
|
| Projektpartner | Fraunhofer-Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme (IMM) |
| Projektkoordinator |
|
| Ansprechpartner | Andreas Vogelpoth M. Sc. |
Ziel des Projektes „OPV4.0“ ist die Herstellung von hocheffizienten und langlebigen organischen Solarzellen, deren Anwendungspotential im Verbundglas demonstriert werden soll. Die Wirkungsgradsteigerung der organischen Photovoltaik (OPV) wird durch die Neuentwicklung von Additiven erreicht, die den Beschichtungsfluiden zugegeben werden. Zudem werden einzelne Prozessschritte innerhalb der Fertigungskette einer Rolle-zu-Rolle-Anlage (R2R) optimiert.
Die Beschichtungsfluide sollen neben dem hohen Wirkungsgrad im OPV-Schichtstapel auch den Anforderungen der Nachhaltigkeit (nicht umweltschädliche und nicht toxische Lösungsmittel), der R2R-Prozessierbarkeit, der Kontaktierbarkeit mittels Inkjet-Verfahren, der Laserprozessierbarkeit und der Eignung für ein Verbundglasverfahren genügen.
Innerhalb des Fraunhofer ILTs umfassen die Prozessschritte für dieses Vorhaben verschiedene Lasertechnologien. Dazu gehören die photonische Trocknung der Beschichtungsfluide, die Zellseparation durch Laserscribing, die Nanostrukturierung zur Effizienzsteigerung und schließlich die Verkapselung der OPV. Die Entwicklung einer strömungs- und temperaturoptimierten Schlitzdüse, die anschließend im Additivdruck hergestellt wird, soll einen optimalen Dünnschichtauftrag ermöglichen.
Ergänzend wird das Digitalisierungspotential einer R2R-OPV-Produktion im Sinne der Industrie 4.0 sowie die Applikationsmöglichkeit im Verbundglas demonstriert. Die Auslegung und Integration von vollflächiger Sensorik und Prozesskontrolle wird zur digitalen Überwachung der einzelnen Sub-Prozesse in der Serienproduktion und damit zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit führen. Durch das Vorhaben wird erstmals eine vollständige, wirkungsgradoptimierte Prozesskette zur OPV-Produktion bereitgestellt und das Anwendungspotential von OPV im Verbundglas demonstriert.
Projektinformationen
| Titel | »OPV4.0« - Kontinuierliche Produktion Organischer Photovoltaik zur Anwendung im Verbundglas |
|---|---|
| Laufzeit | 01.06.2024 bis 31.5.2027 |
| Gefördert durch | EFRE/JTF-Programm NRW |
| Projektträger | Jülich (PtJ) |
| Beteiligte Projektpartner |
|
| Projektkoordinator | Ruhr-Universität Bochum |
| Ansprechpartner | Lena Hellmann M.Eng. (-> E-Mail senden) |
Im Förderprojekt ProZeF entwickeln drei Projektpartner multidisziplinäres, multimediales und partizipatives Lehr- und Lernmaterial zum Thema Fusion für Projektwochen an weiterführenden Schulen in der Strukturwandel-Region rund um Aachen und darüber hinaus. Schüler*innen lernen dabei die globale Relevanz klimaneutraler Energieversorgung kennen, reflektieren den eigenen Energieverbrauch und erfahren die Grundlagen und Potenziale der Fusion. Ziel ist es, ein Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung zu stärken und Jugendlichen Mut zu machen, sich selbst als aktive Mitgestaltende einer nachhaltigen Zukunft zu sehen.
Projektinformationen
| Titel | »ProZeF« - Projektwoche ZukunftsEnergie Fusion |
|---|---|
| Laufzeit | 01.04.2025 – 31.12.2025 |
| Gefördert durch | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) |
| Projektträger | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) |
| Beteiligte Projektpartner |
|
| Projektkoordinator | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Peter Trechow |
| Ansprechpartner | Peter Trechow (-> E-Mail senden) |
Im Projekt DIOHELIOS – ein Verbundprojekt im Rahmen des übergeordneten BMBF-Förderprogramms Fusion 2040 - Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk – betrachten die Partner diverse Fragestellungen entlang der Wertschöpfungskette eines Diodenlaser-Pumpmoduls für Hochenergielaser. Unter anderem geht es um die Entwicklung maßgeschneiderter, hocheffizienter Diodenlaser-Barren, deren Stapelung in einem kompakten Design mit hohem Füllfaktor, um die Strahlformung mit optimierten Optikkomponenten, die Versorgung mit hochdynamischen Stromtreibern sowie eine speziell angepasste Kühltechnik. Schließlich wird ein skalierbares Konzept für Hochenergie-Pumpquellen präsentiert und anhand von Labor-Demonstratoren mit >80 kW bzw. bis zu >1 MW Spitzenleistung an einem im Projekt entwickelten Messstand validiert. DIOHELIOS verfolgt besonders innovative Ansätze wie wellenlängenstabilisierte Multi-Junction-Laserbarren, ein Montage-Konzept mit effizienter Wärmeabfuhr sowie die Automatisierung von Prozessen mithilfe KI-gestützter Verfahren.
Projektinformationen
| Titel | »DioHELIOS« - Diodenlaser-Pumpquellen für Hochenergielaser in Fusionskraftwerken |
|---|---|
| Laufzeit | 01.10.2024 - 30.09.2027 |
| Gefördert durch | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) |
| Projektträger | VDI Technologiezentrum GmbH |
| Beteiligte Projektpartner | |
| WEBSEITE | BMFTR |
| Projektkoordinator | Dr. Dirk Sutter, TRUMPF Laser AG (-> E-Mail senden) |
| Ansprechpartner | Dipl.-Ing. Hans-Dieter Hoffmann (-> E-Mail senden) |
| Mehr Lesen | Pressemeldung |
Im Pilotprojekt gehen die Partner grundlegende Arbeiten zu Lasersystemen, den optischen Komponenten, Schädigungs- und Zerstörschwellen (LIDT) über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg an. Im Fokus stehen hierbei Spiegel, Linsen und Gitter:
- Untersuchung neuer optischer Materialien
- Neuartige Herstellungsverfahren für Optiken
- Neue Klassen optischer Beschichtungen
- In-situ Charakterisierung
- Techniken zur Schädigungsreduktion
Erarbeitung eines holistischen Gesamtkonzepts zu laserinduzierten Schädigungsmechanismen
Projektinformationen
| Titel | »PriFUSIO« - Prioritäre Maßnahme Fusion |
|---|---|
| Laufzeit | 01.02.2024 - 31.01.2027 |
| Gefördert durch | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) |
| Projektträger | VDI Technologiezentrum GmbH |
| Beteiligte Projektpartner |
|
| WEBSITE | BMFTR |
| Projektkoordinator | Dipl.-Ing. Hans-Dieter Hoffmann (-> E-Mail senden) |
| Ansprechpartner | Dipl.-Ing. Hans-Dieter Hoffmann (-> E-Mail senden) |
| MEHR LESEN | Pressemeldung |
Umwelt
Die QLEO-Mission hat das Ziel, vertikale Profile von Wasserdampf und Aerosolen in der Troposphäre mithilfe eines differentiellen Absorptions-LiDARs bei etwa 935 nm zu erfassen. Aus einer sonnensynchronen Umlaufbahn in 450 km Höhe soll das Instrument detaillierte Informationen zur Struktur und Feuchte der planetaren Grenzschicht, zur Verteilung von Aerosolen sowie zu Wolkengrenzen und deren optischer Tiefe liefern. Für die Messungen werden vier verschiedene Wellenlängen benötigt, die in schnellen Pulsen nacheinander ausgesendet werden. Aktuell steht jedoch keine geeignete, weltraumtaugliche Hochleistungslaserquelle bei 935 nm zur Verfügung.
Um diese technische Herausforderung zu lösen, werden im Projekt zwei verschiedene Ansätze für eine nichtlineare Frequenzkonversion auf Basis eines 1064-nm-Lasers untersucht. Im ersten Ansatz wird das Ausgangssignal zunächst auf 532 nm frequenzverdoppelt und anschließend über einen OPO/OPA-Prozess nach 935 nm umgewandelt. Im zweiten Ansatz erfolgt zunächst eine Umwandlung auf 1870 nm, gefolgt von einer Frequenzverdopplung auf 935 nm. Beide Verfahren werden im Rahmen des Projekts hinsichtlich ihrer Effizienz, Robustheit und Eignung für den Weltraumeinsatz bewertet.
Das Hauptziel besteht darin, den gewählten Ansatz in einem Laboraufbau aufzubauen und zu testen. Dafür wird ein technisches Breadboard realisiert, das ein Technology Readiness Level (TRL) 4 erreicht. Im Fokus stehen dabei die Auslegung und Optimierung des Konversionsschemas, sowie das Design und der Test kritischer optomechanischer Komponenten auf Weltraumtauglichkeit.
Am Ende der Projektphase steht ein validierter Laboraufbau sowie eine Roadmap, wie die Technologie gezielt bis zu einem Engineering Model mit TRL 5 bis 6 weiterentwickelt werden kann. Damit wird die Grundlage für den zukünftigen Einsatz der Strahlquelle in weiteren Weltraummissionen wie QLEO geschaffen.
Projektinformationen
| Titel | »QLEO« -Laser Breadboard for Future Water Vapor LIDAR |
|---|---|
| Laufzeit | 01.10.2025 - 30.09.2027 |
| Projektträger |
|
| Projektpartner | Unteraufträge an Airbus Defence & Space und Ruphos |
| Ansprechpartner | Dr. Marie Jeanne Livrozet (-> E-Mail senden) |
»SIROCO« - SImple and RObust laser source for spaCeborne lidar with cavity and injection free Optical parametric oscillators
Das Projekt SIROCO (SImple and RObust laser source with EU supply chain and Cavity and injection-free Optical parametric oscillator for spaceborne lidar) zielt darauf ab, die Unabhängigkeit der EU bei Hochleistungslasern im augensicheren Bereich zu erreichen. Es soll eine Lösung auf der Grundlage der Wellenlängenkonversion eines 1-µm-Lasers entwickelt werden, die die Unabhängigkeit der EU-Lieferkette für Lösungen zur Emission von Leistungslasern im Bereich von 1,5 bis 3 µm gewährleistet. Ein solcher bahnbrechender Laser wird die Grundlage für die nächsten weltraumgestützten Sensoren für Treibhausgase (THG) durch integriertes Pfad-Differentialabsorptions-Lidar (IPDA) bilden, mit dem die jeweiligen THG in den augensicheren Bereichen von 1,6 µm oder 2 µm untersucht werden können. Um die hohen Anforderungen an die spektralen, räumlichen und energetischen Strahleigenschaften zu erfüllen, sind effiziente und vielseitige Wellenlängenkonverter wie Optisch-Parametrische Oszillatoren (OPOs), die von ausgereiften 1-µm-Leistungslasern gepumpt werden, Schlüsseltechnologien. Dies ist auch der Ansatz bei der European Methane Remote Sensing Lidar Mission (MERLIN).
SIROCO wird innovative, kritische optische Weltraumtechnologien bis zum TRL6 ausreifen, darunter einen hybriden Faser-/Bulk-1-µm-Laser in Kombination mit einem neuen Backward-Wave-OPO-Konzept (BWOPO). Dies wird zu einer drastischen Vereinfachung im Vergleich zum Stand der Technik führen, da weder ein optischer Resonator (höhere Robustheit und einfachere Integration) noch eine OPO-Seed-Quelle (höhere Kompaktheit und Einfachheit bei der Wellenlängensteuerung) erforderlich sind. Es wird die Wettbewerbsfähigkeit der EU durch schnellere, integrierte, weniger riskante und empfindliche zukünftige Weltraum-Lidar erhöhen. In SIROCO werden nichtlineare Kristalle entwickelt, um eine EU-Lieferkette sicherzustellen, die Schlüsselkomponenten für verschiedene Anwendungen sind (allgemeine Laserphysik, Lidar-Emitter, Quantentechnologie). Ihr Weg zur Nutzung für zukünftige Weltraum-Lidar und Quantenkommunikation wird durch entsprechende Roadmaps vorgezeichnet.
Projektinformationen
| Titel | »SIROCO« - SImple and RObust laser source for spaCeborne lidar with cavity and injection free Optical parametric oscillators |
|---|---|
| Laufzeit | 01.12.2024 - 30.11.2028 |
| Gefördert durch |
|
| Projektträger |
|
| Projektkoordinator | ONERA, Myriam Raybaut |
| Projektpartner |
|
| Ansprechpartner | Dr. Patrick Baer (-> E-Mail senden) |
| Projektseite | SIROCO |
Das Projekt »Laserbasierte Beschichtung von Elastomer-Bauteilen mit Anti-Haft-Schichten (LEMBAS)« zielt auf die Entwicklung eines neuartigen, laserbasierten Beschichtungsverfahrens für elastomere Walzen und Rollen, wie sie in der Folienherstellung, Verpackungsindustrie, Papierproduktion, Hygieneartikeln und Medizintechnik eingesetzt werden.
Statt der bislang üblichen, wenig beständigen Silikonbeschichtungen sollen hochfunktionale Anti-Haft-Schichten auf Basis von Hochleistungspolymeren (z. B. PEEK, Polyamid, Polyproylen) aufgebracht werden, die deutlich höhere Abrasionsbeständigkeit, chemische Beständigkeit und Lebensdauer bieten. Bei der Materialentwicklung wird auf den Einsatz von sogenannten Ewigkeitschemikalien (PFAS) inklusive Chemikalien, bei denen diese auch in der Produktion anfallen (z.B. PTFE), verzichtet. Im Vordergrund steht die Entwicklung nachhaltigerer Alternativen.
Da Elastomere nur begrenzt temperaturstabil sind, wird Laserstrahlung genutzt, um sehr hohe Temperaturen lokal und für kurze Zeit im Beschichtungsmaterial zu erzeugen, ohne das elastomere Substrat thermisch zu schädigen.
Kern des Projekts ist die Entwicklung:
- einer Adhäsions- bzw. Zwischenschicht, die das Elastomer vor thermischer Belastung schützt und eine zuverlässige Haftung zur Anti-Haft-Schicht sicherstellt,
- lasergeeigneter Anti-Haft-Materialsysteme mit angepassten optischen und rheologischen Eigenschaften,
- geeigneter Depositions- und Laservorbehandlungsverfahren
Durch das neue Verfahren sollen höhere Prozessgeschwindigkeiten und breitere Warenbahnen möglich, der Einsatz von Reinigungs- und Lösungsmitteln um bis zu ca. 40 % reduziert, Produktverunreinigungen durch Abrieb minimiert und der Energieaufwand in der Beschichtung gegenüber Ofenprozessen um bis zu 90 % gesenkt werden. Demonstratorwalzen dienen zur Validierung und zum Scale-up für industrielle Anwendungen.
Projektinformationen
| Titel | Laserbasierte Beschichtung von Elastomer-Bauteilen mit Anti-Haft-Schichten - LEMBAS |
|---|---|
| Laufzeit | Januar 2025 bis Dezember 2026 |
Projektträger |
|
| Fördergeber | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) |
| Projektpartner |
|
| Projektkoordinator |
|
| Ansprechpartner | Adam El-Sarout (-> E-Mail senden) |
Ziel des SAHEP-Vorhabens ist die Entwicklung einer kostengünstigen Inline-Sonde für die Abwasseranalytik aufbauend auf dem Funktionsprinzip der 2D-Fluoreszenzspektroskopie. Eine neuartige Lichtquelle wahlweise auf Basis einer Einzelfilament-Plasmaentladung oder aber auf UV LED-Basis bietet die Möglichkeit, die zurzeit bestehenden Limitierungen der üblichen UV-Lichtquellen, die für die Fluoreszenzspektroskopie eingesetzt werden, zu überwinden. Mit dieser Lichtquelle soll eine inline 2D-Fluoreszenzsonde entwickelt werden, die eine neue Form der kontinuierlichen Überwachung von Wasseraufbereitungsprozessen ermöglicht.
Projektinformationen
| Titel | »SAHEP« – Spektroskopische Abwasseranalytik mit Hilfe von Einzelfilament UV Plasmalichtquellen |
|---|---|
| Laufzeit | 01.04.2024 - 31.03.2027 |
| Gefördert durch | EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 |
| Projektträger | Projektträger Jülich |
| Projektkoordinator | Bühler Technologies GmbH |
| Projektpartner | Bühler Technologies GmbH Fraunhofer ILT Wasserverband Eifer-Rur |
| Ansprechpartner | Dr. Christoph Janzen (-> E-Mail senden) |
»RePEEK« – Verfahren zur Herstellung PFAS-freier Hochleistungsbeschichtungen auf Basis von Polyetheretherketon (PEEK)
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS, sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Allerdings werden PFAS seit einiger Zeit als akut umwelt- und gesundheitsschädlich eingestuft. Durch ihre Langlebigkeit als sogenannte Ewigkeitschemikalien (Forever Chemicals) können sie inzwischen praktisch überall auf der Erde, in Menschen und Tieren nachgewiesen werden. Daher ist die Entwicklung neuer Verfahren und Materialien, die PFAS durch umweltfreundliche und unbedenkliche Lösungen ersetzen, dringend nötig. Im Projekt RePEEK bringt das Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT PFAS-freie Hochleistungs-Beschichtungen in die Anwendung. Der Schlüssel liegt dabei in der Herstellung eines hybriden Schichtverbunds aus einer additiv gefertigten Metallschicht im EHLA-Verfahren (Extremes Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen) und einer Beschichtung aus dem Hochleistungspolymer PEEK (Polyetheretherketon). Den Kern der Lösung stellt die Kombination zweier Verfahren in einem Hybridverfahren dar. In einem ersten Schritt wird eine Metallschicht mittels EHLA auf ein Metallbauteil aufgetragen. Direkt danach erfolgt die Beschichtung mit PEEK-Pulver, welches auf dem noch hießen Bauteil direkt aufschmilzt. Dieser Ansatz bringt entscheidende Vorteile mit sich:
- Herstellung eines komplexen Schichtsystems in einem einzigen Verfahrensschritt
- Vermeidung eines energieintensiven Ofenprozesses
- Erreichen von sehr hohen Haftfestigkeiten durch mechanische
Verklammerung von Metall- und PEEK-Schicht. Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Projekts ist die Kombination zweier Verfahren in unmittelbarer, räumlicher Nähe zueinander und die Nutzung von verfahrensspezifischen Prozess- und Bauteileigenschaften (Restwärme und Oberflächenbeschaffenheit). Durch die Kombination dieser beiden Verfahren in einem Bearbeitungskopf kann bei minimalem Mehraufwand eine erhebliche Wertsteigerung erreicht werden, welche sogar als Drop-in-solution in bestehende Anlagen oder Systeme integriert werden kann.
Projektinformationen
| Titel | »RePEEK« – Verfahren zur Herstellung PFAS-freier Hochleistungsbeschichtungen auf Basis von Polyetheretherketon (PEEK) |
|---|---|
| Laufzeit | 01.07.2025 – 31.12.2026 |
| Projektträger | Fraunhofer Zukunftsstiftung |
| Gefördert durch | Fraunhofer Zukunftsstiftung |
| Projektpartner | Verschiedene assoziierte Partner aus der Industrie |
| Projektkoordinator | Andreas Dockhorn, Roxana Wolf |
| Ansprechpartner | Dr. Samuel Fink (-> E-Mail senden) |
»PRECIRC« – Laserbasierte Reparaturprozesskette zur Steigerung der Ressourceneffizient in der Kreislaufwirtschaft metallischer Präzisionsbauteile
Bauteile, die starkem Verschleiß und Korrosion ausgesetzt sind, versagen häufig aufgrund lokaler Oberflächenschäden. Der Ersatz ausgefallener Komponenten ist ressourcenintensiv und das Recycling metallischer Bauteile erfordert energieintensive Schmelzprozesse. Darüber hinaus führt der steigende Bedarf an immer knapper werdenden Rohstoffen zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von Importländern und verursacht durch die im Herstellungsprozess entstehenden CO2-Emissionen einen erheblichen ökologischen Fußabdruck.
Am Fraunhofer ILT wird im Rahmen des Forschungsprojektes »PRECIRC« eine automatisierte hybride Prozesskette für die nachhaltige Reparatur von metallischen Bauteilen entwickelt. Durch die Kombination des Drehverfahrens mit dem Extremen Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen (EHLA) wird eine Prozesskette geschaffen, die sowohl die additive Fertigung als auch die Vor- und Nachbearbeitung der Bauteile in einer Aufspannung ermöglicht.
Projektinformationen
| Titel | »PRECIRC« – Laserbasierte Reparaturprozesskette zur Steigerung der Ressourceneffizient in der Kreislaufwirtschaft metallischer Präzisionsbauteile |
|---|---|
| Laufzeit | 01.08.2023 – 31.07.2026 |
| Gefördert durch | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Jülich (PtJ) |
| Projektpartner | Richter GmbH & Co. KG, LUNOVU GmbH, MABRI.VISION GmbH, Center Connected Industry |
| Ansprechpartner | Viktor Glushych M. Sc. (-> E-Mail senden) |
| Webseite | Projektwebsite »PRECIRC« |
Durch die Bemühungen um eine Eindämmung des Klimawandels wird das Verständnis und die Überwachung der Physik der Atmosphäre (einschließlich der Wind- und Temperaturverteilung in der Atmosphäre) immer wichtiger. Sie ist entscheidend für die Verbesserung von Klimamodellen und Wettervorhersagen. Es gibt jedoch eine Datenlücke für kontinuierliche Messungen oberhalb von 5 km, der maximalen Höhe kommerzieller kompakter Windradar- und -lidarsysteme. Im Rahmen des von der EU finanzierten EULIAA-Projekts soll ein Lidar-Array entwickelt werden, das den atmosphärischen Wind und die Temperatur in einem Bereich von 5 km bis 50 km rund um die Uhr über einen langen Zeitraum (mehr als ein Jahr ohne Wartung) autonom misst und ein großes Beobachtungsgebiet (bis zu 10 000 km2) abdeckt. Die neuen Lidar-Einheiten sind preisgünstig, kompakt, effizient, leicht zu transportieren und können durch Windturbinen oder Solarzellen betrieben werden.
EULIAA wird neuartige Datensätze in nahezu Echtzeit liefern, die in die europäischen Datenbanken Copernicus und GEOSS aufgenommen werden können, um aktuelle Datenlücken zu schließen und die Auswirkungen des Klimawandels zu überwachen sowie Klimaschutzmaßnahmen zu bewerten.
Sobald die im Rahmen von EULIAA entwickelten verbesserten Fähigkeiten in schwer zugänglichen Regionen (Polar-, Äquator- und Gebirgsregionen) mit einem hohen TRL (6-8) demonstriert und validiert wurden, werden ein Geschäftsplan und eine Roadmap für ein europäisches Lidar-Array erarbeitet, an dem relevante Akteure aus Industrie, Normung und Endnutzern beteiligt sind.
Das EULIAA-Projekt (Laufzeit 48 Monate, Budget 3,2 Mio. €) vereint 7 Partner aus 5 Ländern mit Experten für Lidar und seine Subsysteme, atmosphärische Observatorien und Anbieter atmosphärischer Daten. Es umfasst alle notwendigen Disziplinen, um die technologische Entwicklung, den Datentransfer und die nachhaltige Nutzung zu gewährleisten. Weltraumanwendungen entwickelte Technologien, rauscharme faserbasierte Verstärker aus der Entwicklung für LISA und variable Frequenzkonversion aus MERLIN, transferiert, indem sie angepasst und kombiniert werden, was einen hohen Technologischen Reifegrad ermöglicht.
Projektinformationen
| Titel | »EULIAA« – European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring |
|---|---|
| Laufzeit | 01.01.2023 – 31.12.2026 |
| Gefördert durch | HEU2.6 - Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment – Environmental Observation |
| Projektträger | Horizon Europe, Grant agreement ID: 101086317 |
| Partner | Fraunhofer Institute für Lasertechnik (ILT), Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP), Altechna, Andøya Space, Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz, LATMOS Laboratoire Atmosphères, Observations Spatiales und GordienStrato |
| Ansprechpartner | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. – Fraunhofer ILT, Michael Strotkamp (-> E-Mail senden)
|
| WEBSITE | Projektwebsite »EULIAA« |
Maßgeschneiderte Lasertechnik für den Einsatz im Orbit
Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT entwickelt seit vielen Jahren Technologien für raumfahrttaugliche Laser. Eine besondere Aufgabe liegt in der Entwicklung eines Lasersystems für die satellitengetragene Messung klimarelevanten Methans. Im Rahmen der deutsch-französischen Klimaforschungsmission »MERLIN« soll dazu ein Licht-Radar (LIDAR) eingesetzt werden, das mittels Laserpulsen die Konzentration des Methans in der Atmosphäre misst und dabei, anders als bisher, unabhängig von Sonnenlicht ist. Die Anforderungen an das Lasersystem sind hoch. Es muss trotz hoher Vibrationslasten und Temperaturschwankungen über Jahre wartungsfrei im All arbeiten. Hierzu entwickelten unsere Wissenschaftler im Rahmen des Projektes »Optomech II/III« (gefördert durch BMWi) eine neue optomechanische Aufbaumethode. So können notwendige Komponenten präzise und stabil in die LIDAR-Laserstrahlquelle integriert werden. Diese basiert auf einer Technologieplattform, die innerhalb des »FULAS« Projektes (gefördert durch ESA) entwickelt wurde. Erste Thermaltests unter realistischen MERLIN-Bedingungen hat das System erfolgreich abgeschlossen. Der Start der MERLIN-Mission ist für 2021 geplant. Der deutsche Teil des MERLIN-Projektes wird durch das BMWi gefördert.
Projektinformationen
| Titel | »MERLIN« - Methane Remote Sensing LIDAR Mission |
|---|---|
| Laufzeit | Ab 2010 |
| Beteiligte Forschungspartner | DLR Raumfahrtmanagement, Airbus Defence & Space, CNES - Centre national d'études spatiales |
| Gefördert durch | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) |
| Website | Projektwebsite des DLR Raumfahrtmanagements |
| Ansprechpartner | Dipl.-Ing. Hans-Dieter Hoffmann (-> E-Mail senden) |
LaserWay verfolgt das Ziel, die Fertigungsindustrie durch Hochgeschwindigkeits-Laserprozesse zu revolutionieren. Der Fokus liegt dabei auf dem Ersatz konventioneller Fertigungsprozesse durch hochpräzise Laserprozesse mit gesteigerter Produktivität. Ein zentrales Ziel ist die signifikante Reduzierung von CO2-Emissionen, um eine nachhaltigere Produktionsweise zu fördern. Letztlich möchte LaserWay wettbewerbsfähige, flexible und umweltfreundliche Fertigungslösungen anbieten.
Projektinformationen
| Titel | »LaserWay« – Extreme Hochgeschwindigkeits Laserprozesse für nachhaltige und flexible Fertigung |
|---|---|
| Laufzeit | 01.01.2024-31.12.2026 |
| Projektträger | Europäische Kommission |
| Beteiligte Forschungspartner |
|
| Gefördert durch | Europäische Union |
| Website | Projektwebsite |
| pROJEKTKOORDINATOR | Ideko (Website) |
| Ansprechpartner ILT | Min-Uh Ko (-> E-Mail senden) |
»RUBIN« – LidarCUBE - Hochpräzise Messtechnik für online Wetter-/Klimamessungen in der gesamten mittleren Atmosphäre
Das RUBIN-Bündnis „LidarCUBE“ besteht aus neun vorwiegend regionalen Industrie- und Forschungspartnern. Das gemeinsame Ziel ist die Prototypenentwicklung eines weltweit und mobil einsetzbaren Lidar-Messinstrumentes für automatische Atmosphärenmessungen. Das entstehende Hochtechnologieprodukt LidarCUBE wird zukünftig die Durchführung von weltweiten Atmosphärenmessungen ermöglichen und weltweit einmalig.
Das Fraunhofer ILT entwickelt hierfür die Lasertechnologie auf Basis von Alexandrit weiter und bereitet einen Technologietransfer vor.
Projektinformationen
| Titel | »RUBIN« – LidarCUBE - Hochpräzise Messtechnik für online Wetter-/Klimamessungen in der gesamten mittleren Atmosphäre |
|---|---|
| Laufzeit | 1.4.2023 – 30.6.2026 |
| Projektträger | Projektträger Jülich - PTJ |
| Beteiligte Forschungspartner |
|
| Gefördert durch | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
| Website | Projektwebsite BMBF |
| pROJEKTKOORDINATOR | LiCuSpace GmbH, Helmut Gutzman (-> E-mail senden) |
| Ansprechpartner ILT | Dr. rer. nat. Michael Strotkamp (-> E-Mail senden) |
Gesundheit
Collaboratives Lasersystem mit Optischer Diagnostik von Lebensbedrohlichen Knochentumoren für die Strukturerhaltende Curative MKG-Chirurgie – »COOLCUT«
Das Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle zählt mit jährlich 600.000 Neuerkrankungen zu den häufigsten Krebsarten. Bei ausgedehnten Tumoren ist oft auch der Kieferknochen betroffen, weshalb dieser routinemäßig reseziert wird. Da es jedoch kein Schnellschnittverfahren für das Knochengewebe gibt und um sicherzustellen, dass der Tumor vollständig entfernt wird, wird dabei häufig ein großzügiges Kieferknochensegment entfernt. Retrospektive Studien zeigen jedoch, dass in 45 % der Fälle der Kieferknochen nicht vom Tumor befallen war.
Ein intraoperatives Messverfahren könnte daher helfen, unnötige Resektionen des Kieferknochens zu vermeiden. In Kombination mit einem hochpräzisen Laserschneidprozess wäre es sogar möglich, bei leichtem Befall des Knochens minimalinvasive chirurgische Eingriffe durchzuführen und dabei den Kieferknochen zu erhalten.
Aus diesem Grund wird ein robotisches Laseroperationssystem zur präzisen Resektion von tumorbefallenen Kieferknochen entwickelt. Ein durch ein Roboterarm geführter Applikator führt den Laserschnitt durch, während ein OCT-Messstrahl die Schneidtiefe überwacht. Der Laserapplikator bewegt sich entlang einer zuvor anhand präoperativer CT- oder MRT-Daten berechneten Schnittlinie, um kleine Knochensegmente auszuschneiden. Während der Resektion analysiert ein LIBS-Sensor die chemische Zusammensetzung des abgetragenen Materials, um die Verteilung der Tumorzellen in Echtzeit zu bestimmen. Basierend auf diesen Daten wird die Solltrajektorie für den Schnitt dynamisch angepasst und in einer VR-Anzeige visualisiert. Das gesamte kollaborative robotische Laseroperationssystem wird als Demonstrator umgesetzt und in einem experimentellen OP des UK Aachen installiert.
Projektinformationen
| Titel | COllaboratives Lasersystem mit Optischer Diagnostik von Lebensbedrohlichen Knochentumoren für die Strukturerhaltende CUraTive MKG-Chirurgie – COOLCUT |
|---|---|
| Laufzeit | 01.08.2024 - 31.07.2027 |
| Projektträger | Innovationsförderagentur.NRW c/o Forschungszentrum Jülich GmbH |
| Gefördert durch | Land NRW |
| Beteiligte Projektpartner | DigitalTwin Technology, Edgewave GmbH, UK Aachen |
| Projektkoordinator | Fraunhofer ILT |
| Ansprechpartner ILT | Dr.-Ing. Milena Zuric (-> E-Mail senden) |
INTEGER - Interaktives KI-gestütztes Laserosteotom zur sicheren gewebeschonenden Resektion maligner Knochentumore
Tumorzellen im Knochen intraoperativ erkennen und hochpräzise entfernen
BMFTR-Fördermaßnahme zu Gesundheitstechnologien im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs (NDK) zum Thema „KI-gestützte Präzisionschirurgie in der Onkologie“
Motivation
Von primären Knochentumoren sind in erster Linie Kinder betroffen. Mit einer Fünf-Jahres-Überlebensrate von nur 70 Prozent hat die Erkrankung eine schlechte Prognose. Die hohe Sterblichkeit liegt auch daran, dass es aktuell noch nicht möglich ist, die einzelnen Tumorzellen im Knochen während der OP zu erkennen, um sie gezielt entfernen zu können. Der Verbleib der Zellen im Knochen führt zu erneuter Tumorausbreitung.
Ziele und Vorgehen
Daher entwickeln die Forschenden ein Laserchirurgie-System, mit dem Chirurginnen und Chirurgen Tumoren sicher und ohne Rückstände aus dem Knochen entfernen und dabei möglichst viel gesundes Knochengewebe erhalten können: Es besteht aus einem spektroskopischen Lasermesssystem, das einzelne Tumorzellen und kleinere Tumorzellverbände im Knochen während des laserchirurgischen Prozesses nachweisen kann. Eine Künstliche Intelligenz vergleicht die spektroskopisch gemessene Tumorverteilung mit zuvor erstellten CT-Bildern der Knochentumoren und instruiert ein robotisches Assistenzsystem, damit es während der OP bei der Schnittführung unterstützt. Die hochpräzise Entfernung der Knochentumoren erfolgt mithilfe eines Laserskalpells, dessen Kurzpulslaserstrahlung eine Wellenlänge aufweist, die vom Knochengewebe stark absorbiert wird.
Innovationen und Perspektiven
Das zu entwickelnde System kombiniert intraoperativen Tumornachweis und hochpräzise Laserchirurgie. Dadurch ermöglicht es, Knochentumoren vollständig zu entfernen und die Prognose der Betroffenen deutlich zu verbessern.
Projektinformationen
| Titel | INTEGER - Interaktives KI-gestütztes Laserosteotom zur sicheren gewebeschonenden Resektion maligner Knochentumore |
|---|---|
| Laufzeit | 01.11.2025 - 31.10.2028 |
| Projektträger |
|
| Gefördert durch | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) |
| Projektvolumen | 2,68 Mio. € (davon 76% Förderanteil durch BMFTR) |
| Beteiligte Projektpartner |
|
| Projekt Webseite | Interaktive-Technologien |
| Projektkoordinator | Fraunhofer ILT |
| Ansprechpartner ILT | Dr. Georg Meineke (-> E-Mail senden) |
Quanten-Licht für eine neue Bildgebung zur frühen und differenzierten Erkennung von Biomarkern in der personalisierten Medizin »QEED«
Mithilfe der Infrarotspektroskopie können gesundes und krankhaft verändertes Gewebe in histologischen Schnitten klassifiziert werden. Biochemische Marker mit spektralen Merkmalen im mittleren Infrarot (MIR) ermöglichen eine Identifikation von Tumorsubtypen und eine spezifische Therapie. Klassische MIR-Spektroskopie-Verfahren benötigen jedoch für ausreichend hochaufgelöste Messungen lange Messzeiten, was die Einführung dieses Verfahrens in die klinische Diagnostik erschwert.
Im Rahmen des Verbundprojekts »QEED« wird ein neues Messverfahren auf Basis verschränkter Photonenpaare, die “Quantum-Enhanced Early Diagnostics“, kurz QEED-Mikroskopie, entwickelt. Basierend auf dem physikalischen Effekt der Quanteninterferenz wird die Messinformation aus dem mittleren Infrarot in das rauscharm detektierbare nahe Infrarot übertragen. Für die Rekonstruktion der MIR-Messinformation werden am Fraunhofer ILT die benötigten hochauflösenden, maßgeschneiderten Spektrometer sowie effiziente Auswertealgorithmen entwickelt und auf FPGA-basierter Echtzeitelektronik implementiert.
Die QEED-Mikroskopie wird als modulare Erweiterung zu klassischen Licht- und Fluoreszenzmikroskopen entwickelt und am Tiermodell sowie in klinischen Studien bewertet.
Projektinformationen
| Titel | Quanten-Licht für eine neue Bildgebung zur frühen und differenzierten Erkennung von Biomarkern in der personalisierten Medizin |
|---|---|
| Laufzeit | 01.01.2023 - 31.12.2027 |
| Projektträger | VDI Technologiezentrum |
| Gefördert durch | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
| Beteiligte Projektpartner |
|
| Projektkoordinator | LaVision BioTec GmbH Dr. Marcel Müller |
| Ansprechpartner ILT | Fabian Wendt (-> E-Mail senden) |
»SAVECUT« – Robotisch Assistiertes Laserosteotom für die Chirurgische Therapie in der Nähe von Risikostrukturen
In Deutschland werden jährlich 620.000 Operationen an der Wirbelsäule durchgeführt. Davon fallen 111.000 Operationen auf die chirurgische Therapie von Spinalkanalstenosen. Das sind knöcherne Verengungen des Wirbelkanals, die das Rückenmark und die Nervenwurzel komprimieren. Die Kompression führt zu Schmerzen in Rücken und Extremitäten und in schwerwiegenden Fällen zu Taubheitsgefühl und Lähmungserscheinungen. Der Operateur muss zur Dekompression des Wirbelkanals den Wirbelkörper unter hohem Anpressdruck auffräsen und den Prozess am Durchstoßpunkt zum Rückenmark instantan stoppen. In 1,5% der Fälle gelangt der Fräskopf in den Wirbelkanal. Dabei werden das Rückenmark oder die Nervenwurzel verletzt, was schwerwiegende Folgen für die Betroffenen wie eine Querschnittslähmung oder Darm-Blaseninkontinenz zur Folge hat. Ziel des Projektes SAVECUT ist daher die Entwicklung eines robotisch-assistierten Laseroperationssystems für den sicheren Abtrag von Knochengewebe nahe kritischer neuronaler Strukturen, das den chirurgischen Laserprozess optisch überwacht. Vor Erreichen des Rückenmarks stoppt der Laserprozess instantan, um schwere Verletzungen zu verhindern.
Projektinformationen
| Titel | SAVECUT – Robotisch Assistiertes Laserosteotom für die Chirurgische Therapie in der Nähe von Risikostrukturen |
|---|---|
| Laufzeit | 01.11.2024 – 31.10.2027 |
| Projektträger | VDI Technologiezentrum GmbH |
| Fördergeber | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt |
| Projektpartner | KLS Martin, Amphos, Neura Robotics, ImFusion, Universitätsklinikum Aachen |
| Projektkoordinator | KLS Martin |
| Ansprechpartner | Christina Giesen M.Sc. (-> E-Mail senden) |
Produktion und Industrie 4.0
Der BMBF-Forschungscampus Digital Photonic Production (DPP) ist die Keimzelle des Clusters Photonik auf dem RWTH Aachen Campus. Das Cluster Photonik, eines von sechs Startclustern auf dem RWTH Aachen Campus, ist spezialisiert auf die Erforschung und Entwicklung von Verfahren zu Erzeugung, Formung und Nutzung von Licht, insbesondere als Werkzeug für die industrielle Produktion.
Projektinformationen
| Titel | BMBF-Forschungscampus »Digital Photonic Production« |
|---|---|
| Laufzeit | 2015-2030 |
| Projektträger | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
| Gefördert durch | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
| Website | Forschungscampus DPP |
| Ansprechpartner | Dr. Christian Hinke (-> E-Mail senden) |
»LASHARE« – Laser equipment ASsessment for High impAct innovation in the manufactuRing European industry
LASHARE ist ein Projekt an dem mehr als 30 Klein- und Mittelständische Unternehmen aus ganz Europa, Industriepartner und sechs der bekanntesten Laserforschungseinrichtungen beteiligt sind. LASHARE wird durch das Fraunhofer ILT koordiniert und im Rahmen des »Seventh Framework Programme« der Europäischen Union unter dem Kennzeichen 609046 gefördert.
Das Hauptziel besteht in einem Wissensaustausch im Bereich der laserbasierten Fertigung und dessen Nutzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als wichtiger Erfolgsfaktor für die europäische Fertigung steht der Transfer von innovativen Lösungen vom Labor in industriell robuste Produkte und deren Verbreitung im Mittelpunkt des Projekts.
Projektinformationen
| Titel | Laser equipment ASsessment for High impAct innovation in the manufactuRing European industry - »LASHARE« |
|---|---|
| Laufzeit | Ab 25.9.2013 |
| Gefördert durch | Europäische Union 7th Framework Program: 609046 |
| Website | http://www.lashare.eu/ |
| Ansprechpartner | Dipl.-Ing.(FH) Ulrich Thombansen M.Sc. B.Eng.(hon) (-> E-Mail senden) |
PhotonHub Europe ist eine europäische Initiative für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mehr als 50 Forschungszentren aus dem Bereich Photonik unterstützen mit ihren Angeboten die Nutzung photonischer Technologien in den KMU. Eben diese Technologien sind in acht Plattformen entlang unterschiedlicher Anwendungsbereiche gegliedert. Diese reichen von Komponenten wie Lichtleitfasern über Halbleiterschaltungen mit integrierten photonischen Funktionen (Photonics Integrated Circuit / PIC) bis hin zu laserbasierten Anwendungsverfahren. Ziel des PhotonHub Europe ist dabei der Transfer komplexer Technologien in Unternehmen hinein, sodass diese damit ihre Innovationskraft stärken und ihre Produkte verbessern.
Projektinformationen
| Titel | Photonics Digital Innovation Hub - »PhotonHub Europe« |
|---|---|
| Projektstart | 2021 |
| Gefördert durch | Europäische Union, Horizon 2020 |
| Website | Projektwebseite »PhotonHub Europe« |
| Ansprechpartner | Dipl.-Ing.(FH) Ulrich Thombansen M.Sc. B.Eng.(hon) (-> E-Mail senden) |
»Roll2Sol« – Maskenlose nanoskalige Plasmaätzstrukturierung von Druckwalzen für die Rolle-zu-Rolle-Fertigung funktionaler Folien mittels UV-Nanoimprintlithographie für Solar- und Wasserstofftechnologien
Das vorliegende Projekt "Roll2Sol" adressiert den Innovationswettbewerb Industrie.IN.NRW mit dem thematischen Schwerpunkt "Innovative Werkstoffe und Intelligente Produktion" in Bezug auf die Förderperiode 2021-2027 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Mit dem Fokus auf die Produktion von großflächigen funktionalen Folien mithilfe der UV-Nanoimprint-Lithographie (NIL) im Rolle-zu-Rolle (R2R) Verfahren adressiert das Projekt "Roll2Sol" das Thema Innovative Werkstoffe und intelligente Produktion an mehreren Stellen. Mit den im Projekt hergestellten funktionalen Folien soll der Grundstein zur Erschließung neuer Anwendungsfelder solargetriebener Komponenten für die regenerative Energietechnik gelegt werden. Zum einen sollen Schutzfolien mit “Anti-Soiling”-Funktion für die bestehende Photovoltaik getestet werden, zum anderen sollen mit neuen Werkstoffen aus der Halbleitertechnik Folien mit photokatalytischer Funktion zur Erzeugung von grünem Wasserstoff erforscht werden. Beide Anwendungen sollen auf dem Potential der R2R-Technologie unter Verwendung funktionaler Werkstoffe und innovativem Strukturdesign aufsetzen und die Anwendbarkeit für die regenerative Energietechnik demonstrieren.
Projektinformationen
| Titel | »Roll2Sol« – Maskenlose nanoskalige Plasmaätzstrukturierung von Druckwalzen für die Rolle-zu-Rolle-Fertigung funktionaler Folien mittels UV-Nanoimprintlithographie für Solar- und Wasserstofftechnologien |
|---|---|
| Laufzeit | 05.2024 – 31.12.2027 |
| Projektträger | Projektträger Jülich PtJ |
| Gefördert durch | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) |
| Website | Projektwebsite »Roll2Sol« |
| Projektkoordinator | Schepers GmbH & Co. KG |
| Ansprechpartner | Andreas Dohrn Dipl.-Ing. (-> E-Mail senden) |
| Beteiligte Projektpartner |
|
Das Projekt EPIWIN (Epitaxy with integrated Nanostructuring) zielt auf die Kombination von Laserstrukturierungsprozessen mit einer neuen und innovativen Methode der Epitaxie ab, um die Herstellung von Wafern bis hin zu fertigen Chip-in-Wafern in einer durchgängigen Fließbandproduktion zu ermöglichen. Kernpunkte umfassen die Integration von Laserstrukturierungsanlagen im sub-μm- und ~10 μm-Bereich, den Einsatz von Niedertemperatur-Epitaxieprozessen, sowie die Gesamtintegration in einer Prototypenanlage.
Darstellung des Problems
Die konventionelle Methode zur Herstellung eines Chip-in-Wafers erfordert den Einsatz mehrerer Anlagen, zwischen denen ein stetiger Transport des Wafers in vakuumverschweißten Einwegverpackungen erforderlich ist. Eine Ursache hierfür ist die etablierte Methode für das Wachstum von III-V-Nitrid-Halbleitern, die für die Herstellung notwendig sind. Das Wachstum geschieht durch ein MOCVD-Verfahren (metallo-organic chemical vapor deposition). Hierbei dient Ammoniak als Stickstoffquelle, welches toxisch ist und hohe Wachstumstemperaturen (>1000 °C) benötigt. Zudem wird für das Wachstum ein Fremdsubstrat verwendet, welches für hohe Temperaturen unter Ammoniak- und Wasserstoffatmosphären kompatibel sein muss, was die Auswahl auf Saphir und Silizium beschränkt. Dadurch ist diese Methode mit erheblichen Kosten durch den hohen Energiebedarf, der Beschaffung von Ammoniak und metallorganischen Ausgangsstoffen sowie von Abgasfiltern verbunden.
Darstellung der Innovation
Das patentierte Verfahren der ELEMENT 3-5 GmbH (Deutsches Patent 10 2013 112 785.1) verwendet als aktive Plasmaquelle Streifenquellen, wodurch sich eine Möglichkeit zur Fließbandproduktion ergibt. Besonders ist dabei die Implementierung von Anlagen zur Laserstrukturierung im sub-μm- und 10 μm-Bereich. Die Strukturierung im sub-μm-Bereich sorgt für eine versetzungsarme Schicht bei den weiteren Epitaxie-Prozessen, während der ~10 μm-Bereich eine in-line Segmentierung erzeugt. Die Verknüpfung beider Technologien erlaubt eine Fließbandprozessierung, bei der am Ende der Wafer mit fertigen Bauelementen steht. Dies führt zur Einsparung von Energie und Umweltbelastungen im gesamten Herstellungsprozess und dadurch zu einer deutlichen Kostenreduktion. Zudem ist der Prozess der Element 3-5 GmbH ein Niedertemperatur-Prozess (250°C bis 350°C) und eine Ammoniak-Atmosphäre ist ebenfalls nicht notwendig. Dadurch stehen weitere Substrate, wie zum Beispiel Zinkoxid oder Germanium, zur Verfügung und auch polykristalline oder amorphe Substrate wie Glas oder Folien können beschichtet werden.
Das plasmaunterstützte Verfahren der ELEMENT 3-5 GmbH folgt dem Weg der großflächigen Solarzellenbeschichtung und anderer großflächiger Beschichtungsverfahren. Bereits jetzt verfügt die Prototypenanlage über eine Waferkapazität, die mit den derzeit größten MOCVD-Anlagen vergleichbar ist.
Fraunhofer ILT
Im Bereich der Laserstrukturierung mit Phasenmasken sowie der Direktstrukturierung hat das Fraunhofer ILT bereits einige Arbeiten durchgeführt. Im Bereich der Phasenmaskenstrukturierung wird der Talbot-Effekt genutzt. Mithilfe eines KrF-Excimer Lasers mit einer Wellenlänge von 248 nm konnten Auflösungen im Bereich von sub-μm erreicht werden. In diesen proof-of-principle Experimenten wurde ein Durchsatz von einer Million Strukturen pro Sekunde über eine Fläche von mehreren Quadratmillimetern erzielt. Damit eignet sich diese Methode für die Strukturierung von großen Flächen im sub-μm Bereich.
Für die Strukturierung im ~ 10-μm Bereich eignet sich eine direkte Laserstrukturierung durch den nicht-thermischen UKP-Laserprozess.
Neben der ELEMENT 3-5 GmbH und dem Fraunhofer ILT, ist auch die Innolite GmbH ein Projektpartner im EPIWIN-Projekt. Assoziierter Partner ist die Coherent Laser Systems GmbH. Dank der langjährigen Erfahrung des Fraunhofer ILT auf dem Gebiet der Laserstrukturierung, dem Know-how der ELEMENT 3-5 GmbH auf dem Gebiet der Niedertemperatur-Epitaxie und der Expertise der Innolite GmbH in der Herstellung hochpräziser optischer Elemente sind die notwendigen Kompetenzen für dieses Projekt hervorragend ausgeprägt.
Das Projekt "EPIWIN" wird im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027 mit der Fördermaßnahme "Innovationswettbewerb Industrie.IN.NRW" gefördert. Die Mittel werden vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen bereitgestellt und von der Europäischen Union kofinanziert. Der Start des Verbundprojektes war der 1. Mai 2024. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre.
Projektinformationen
| Titel | »EPIWIN« – Epitaxie mit integrierter Nanostrukturierung |
|---|---|
| Laufzeit | 2024 – 2027 |
| Projektträger | Projektträger Jülich PtJ |
| Gefördert durch |
|
| Projektvolumen | 2,9 Mio. Euro, davon 600 k€ für das ILT |
| Beteiligte Projektpartner |
|
| Ansprechpartner | Dr. rer. nat. Serhiy Danylyuk (-> E-Mail senden) |
Im Projekt HERMES entwickeln das Fraunhofer ISIT und das Fraunhofer ILT eine nachhaltige, universelle Technologieplattform zur Herstellung monolithisch und vertikal integrierter MEMS-Sensoren. Dabei werden Sensor und Auswerteelektronik im selben Herstellungsprozess direkt übereinander auf einem Chip integriert.
Mikrosysteme (MEMS) bestehen üblicherweise aus Sensoren, Aktoren und einer Steuerungselektronik. Mit konventionellen Fertigungsverfahren ist eine kombinierte (monolithische) Herstellung, bei der MEMS-Sensor und Auswerteelektronik (IC) vertikal aufeinander gefertigt werden, bisher nicht möglich. Die verschiedenen Prozesstemperaturen sind nicht miteinander vereinbar, sodass es zu Schädigungen des ICs kommen kann.
Die von ISIT und ILT entwickelte Lösung sieht vor, amorphe Siliziumschichten auf den fertiggestellten Schaltkreisen des IC-Wafers bei niedrigen Temperaturen abzuscheiden. In einem anschließenden Laserbearbeitungsschritt wird die zur Kristallisation der Siliziumschicht benötigte hohe Temperatur erreicht, ohne die darunterliegenden Schaltkreise zu beeinträchtigen. Dies wird durch ortsselektives Aufheizen im Millisekundenbereich realisiert. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass sowohl Sensor als auch IC aus dem gleichen Material bestehen und die gleichen thermomechanischen Eigenschaften besitzen. So können Sensoren aufgebaut werden, die über einen weiten Temperaturbereich zuverlässig auch kleinste Messgrößen erfassen. Die neue Technologie könnte MEMS, die verschiedene mechanische Sensortypen (z. B. für Beschleunigung und Drehmoment) vereinen, kleiner, kostengünstiger und gleichzeitig leistungsfähiger machen. Mögliche Anwendungsbereiche sind z. B. mobile Endgeräte für Verbraucher wie Tablets, Smartphones und Smartwatches oder Fitnessarmbänder. Aufgrund des globalen Marktes mit jährlichen Umsätzen im Milliarden-Dollar-Bereich schafft HERMES nach erfolgreicher Validierung die Basis für Kooperationen mit KMU und Großunternehmen.
Projektinformationen
| Titel | »HERMES« – Herstellung ultrakompakter MEMS-Sensoren mittels laserbasierter Integrationsverfahren |
|---|---|
| Laufzeit | 01.03.2023 – 28.02.2026 (Verlängert bis 31.07.2026) |
| Projektträger | VDI/VDE Innovation + Technik GmbH |
| Gefördert durch |
|
| Beteiligte Projektpartner |
|
| Ansprechpartner | Tobias Brunner (-> E-Mail senden) |
Wasserstoff
Entwicklung und Fertigung von aluminiumbasierten Bipolarplatten mit Anwendung in NT-PEM-Brennstoffzellen
Im Verbundvorhaben AluBIPEM wird die Entwicklung und Fertigung innovativer, aluminiumbasierter Bipolarplatten für Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellen verfolgt. Ziel ist es, durch den Einsatz leichter und kostengünstiger Materialien sowie neuartiger Beschichtungs- und Bearbeitungsverfahren die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellen deutlich zu steigern. Damit soll ein Beitrag zur breiten Einführung von Wasserstofftechnologien in der Mobilität geleistet werden, die für die Energiewende und die Reduktion von CO₂-Emissionen von zentraler Bedeutung sind. Das Projekt bringt Industriepartner, Forschungsinstitute und spezialisierte Unternehmen zusammen, um entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Materialentwicklung über die Fertigung bis hin zur Anwendung neue Lösungen zu erarbeiten.
Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT übernimmt innerhalb des Projekts die Aufgabe, den selektiven Laserabtrag von Sol-Gel-Beschichtungen auf den Bipolarplatten möglich zu machen und zu optimieren. Ziel ist es, ein reproduzierbares, präzises und industriell skalierbares Verfahren zu entwickeln, das die Funktionalität der Platten verbessert und ihre Langzeitstabilität erhöht. Durch die laserbasierte Strukturierung sollen die Beschichtungen gezielt entfernt werden, sodass die elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit gesteigert werden. Das ILT verfolgt damit das Ziel, die Grundlagen für eine effiziente Serienfertigung zu schaffen und die Technologie für den industriellen Einsatz vorzubereiten.
Projektinformationen
| Titel | Entwicklung und Fertigung von aluminiumbasierten Bipolarplatten mit Anwendung in NT-PEM-Brennstoffzellen |
|---|---|
| Laufzeit | 01.01.2024 – 31.12.2026 |
| Projektträger | Projektträger Jülich (PtJ) |
| Fördergeber | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |
| Projektpartner |
|
| Projektkoordinator | Unicorn Engineering GmbH |
| Ansprechpartner | Lena Helllmann M.Eng. (-> E-Mail senden) |
Die steigende Nachfrage nach Wasserstofftechnologien erfordert die Entwicklung moderner Fertigungsverfahren mit sehr hohen Taktzahlen. In diesem Zusammenhang steht momentan besonders die PEM-Brennstoffzelle (PolymerElektrolyt-Membran) im Fokus der aktuellen Forschung und Entwicklung. Eine zentrale Komponente einer PEM-Brennstoffzelle stellen die Bipolarplatten (BPP) dar. Die aggressiven chemischen Bedingungen in einer Brennstoffzelle führen jedoch zur Korrosion der metallischen BPPs. Um der Korrosion entgegenzuwirken und die Lebensdauer der Brennstoffzellen damit zu verlängern, können Beschichtungen aufgebracht werden. Gleichzeitig muss jedoch eine hohe elektrische Leitfähigkeit erhalten bleiben, um eine hohe Effizienz des Systems zu ermöglichen. Konventionell erfolgt die Beschichtung mittels chemischer oder physikalischer Gasphasenabscheidung in Vakuumanlagen. Es werden komplexe Beschichtungsanlagen benötigt und hohe Materialkosten erzeugt.
Im Rahmen des Forschungsprojekts H2GO entwickelt das Fraunhofer ILT ein laserbasiertes Verfahren, welches die Herstellung von neuartigen Korrosionsschutzschichten auf Kohlenstoffbasis ermöglicht. Dabei wird eine Präkursorlösung auf die BPPs aufgesprüht und getrocknet. Durch die anschließende Bearbeitung mit einem Laser wird diese Präkursorschicht in eine leitfähige und korrosionsbeständige Kohlenstoffmodifikation umgewandelt. Die Bearbeitung erfolgt im Gegensatz zur etablierten Gasphasenabscheidung in Raumluft und erfordert kein Vakuum. Dadurch wird eine Integration in eine kontinuierliche Fertigungsstraße erheblich vereinfacht.
Durch den Verzicht auf aufwendige Vakuumverfahren und die Verwendung von günstigen und gut verfügbaren Materialien kann das Verfahren einen Beitrag dazu leisten, den stetig wachsenden Markt der PEM-Brennstoffzellen zu bedienen. Das diesem Bericht zugrundeliegende FuE-Vorhaben wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr unter dem Förderkennzeichen 03B11027A durchgeführt.
Projektinformationen
| Titel | H2GO, Teilverbund HP2BPP, Projektmodul 2, Arbeitspaket 2: Laserbasierte, nasschemische BPP-Beschichtung |
|---|---|
| Laufzeit | 01.05.2022–30.11.2025 |
| Projektträger | BMVI |
| Fördergeber | Projektträger Jülich |
| Website | https://h-2-go.de/ |
| Projektpartner | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK Fraunhofer-Institut für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV |
| Projektkoordinator | Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU |
| Ansprechpartner | Dr. Samuel Fink (-> E-Mail senden), Julius Funke M. Sc (-> E-Mail senden) |
Im R2MEA-Projekt entstehen wegweisende Roll-to-Roll-Fertigungsverfahren für 7-lagige Membran-Elektroden-Einheiten (MEA). Anstelle herkömmlicher Chargen- oder Intervallprozesse setzen wir auf durchgängige Produktionslinien, um Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit maßgeblich zu steigern. Im Fokus stehen dabei folgende Kernpunkte:
- Umstellung der Katalysatorpulverproduktion von einem Chargenprozess auf einen kontinuierlichen Prozess
- Vergleich verschiedener Applikationsmechanismen für Katalysatorschichten
- Kürzere Trocknungszeiten und verkürzte Trocknerlängen durch laserbasiertes Trocknen
- Roll-to-Roll-Prozess zum Zuschnitt von MEA-Komponenten wie Membranen, Unterdichtungen und Gasdiffusionsschichten
- Roll-to-Roll-Positionierungs- und Laminierungsprozesse zur Herstellung 7-lagiger MEAs
- Konzepte für Transportbehälter für MEAs
Projektinformationen
| Titel | Roll to Meambrane Electrode Assembly (R2MEA) |
|---|---|
| Laufzeit | 11.2021-11.2025 |
| Projektträger | Projektträger Jülich |
| Fördergeber | BMDV |
| Website | R2MEA – Series production of mobile fuel cells: Research platform for the roll-to-roll production of MEAs - Fraunhofer ISE |
| Projektpartner |
|
| Projektkoordinator | Ulf Groos (Fraunhofer ISE) |
| Ansprechpartner | Christian Vedder (E-Mail schicken) |
Weitere Themen
Im Projekt ATIQ entwickelt das Fraunhofer ILT gemeinsam mit insgesamt 24 weiteren Projektpartnern zuverlässige Quantencomputer-Demonstratoren für komplementäre Anwendungsfälle, u. a. für die Quantenchemie (Reaktionschemie), das Finanzwesen (Kreditrisikobewertung) und der angewandten Mathematik (Optimierungsprobleme).
Ziel des Projekts ist die Herstellung eines kommerziellen Prototyps auf Basis der Ionenfallen-Technologie mit einer Gesamtzahl an (zunächst) 40 Qubits und einer entsprechend hohen Gatter-Fidelität.
Projektpartner:
Gesellschaft für Angewandte Mikro- und Optoelektronik mit beschränkter Haftung - AMO GmbH, AKKA Industry Consulting GmbH, Black Semiconductor GmbH, eleQtron GmbH, FiberBridge Photonics GmbH, Fraunhofer IOF, Infineon Technologies AG, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Institut für Physik), JoS QUANTUM GmbH, Leibniz Universität Hannover, LPKF Laser & Electronics AG, Parity Quantum Computing Germany GmbH, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (PTB), QUARTIQ GmbH, QUBIG GmbH, RWTH Aachen, TOPTICA Photonics AG, Technische Universität Braunschweig, Universität Siegen
Projektinformationen
| Titel | »ATIQ« - Quantencomputer mit gespeicherten Ionen für Anwendungen |
|---|---|
| Laufzeit | 1.12.2021 – 30.11.2026 |
| Gefördert durch | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF |
| Website | Projektwebsite »ATIQ« |
| Ansprechpartner | Christian Peters M.Sc. (-> E-Mail senden) |
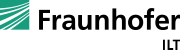 Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT
Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT